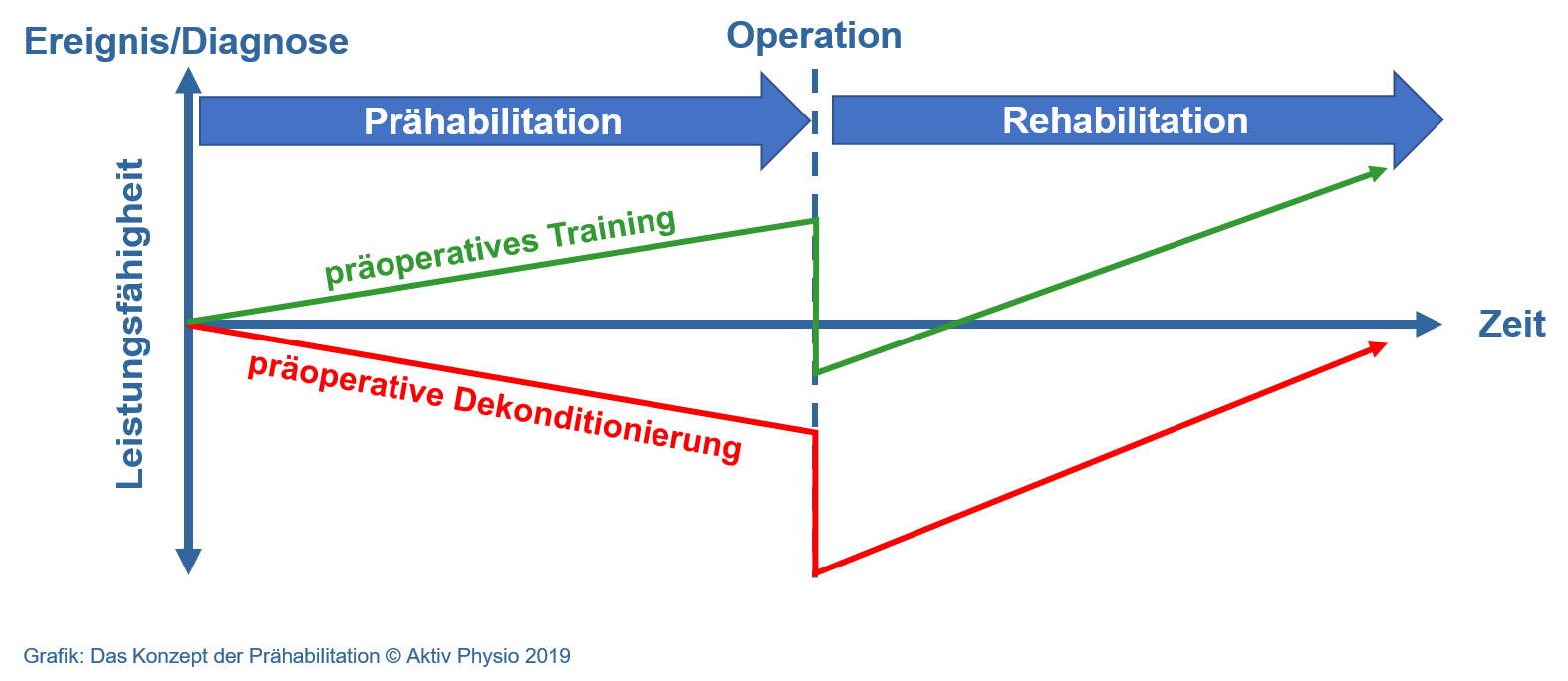Trainieren ist kein Ponyhof – oder – Fortschritte werden ausserhalb der Komfortzone erzielt
Jeder ist so stark wie nötig
Der menschliche Körper ist eine von der Evolution auf Effektivität und Effizienz getrimmte «Maschine». In der gesamten Entwicklungsgeschichte ging es letztendlich immer darum zu überleben, um sich fortzupflanzen – der kritische Erfolgsfaktor war genügend Nahrungsmittel zu haben und – logischerweise – mit seiner Energie haushälterisch umzugehen und keine Kalorie zu viel zu verbrennen.
In Folge dessen ist der Mensch (nur) genauso stark, wie er sein muss, um die täglich an ihn gestellten, maximalen Anforderungen zu erfüllen. Wäre er stärker, würden die zu leistungsfähigen Muskeln zu viel Energie brauchen… die Evolution hätte solchen Genen gnadenlos den Garaus gemacht.
Das alles führt nun eben dazu, dass der Müller die 50-Kilo Getreidesäcke spazieren führt, ohne stark zu schnaufen, während der autofahrende, fernsehende «Bürolist» seiner Frau kaum die Einkaufstasche in den zweiten Stock zu tragen vermag.
Das Ergebnis der Evolution passt nicht in die heutige Zeit
Kombiniert man das obige mit der Erkenntnis, dass wir in den letzten paar Sekunden unserer evolutionsgeschichtlichen Uhr zu viel Nahrung zur Verfügung und gleichzeitig zu wenig Bewegung und zu wenig Anstrengungen haben, haben wir die Ursache für viele moderne Zivilisationsbeschwerden (Stichwort «Sitzen ist das neue Rauchen»).
Es ist heute hinlänglich bekannt und allgemein anerkannt, dass wir (Kraft-)Training betreiben sollen, um unserem Körper zumindest teilweise das zu geben, was er evolutionsgeschichtlich bräuchte, aber aufgrund unserer Lebensweise nicht mehr erhält. Doch was heisst denn «Training» in diesem Zusammenhang eigentlich? Meist besteht das Ziel unserer Kunden darin, Kraft, koordinative Fähigkeiten und Ausdauer zu verbessern.
Was heisst «Training»?
Lassen sie uns das Wort «verbessern» ins Zentrum rücken: Basierend auf dem eingangs erwähnten Effizienzprinzip unseres Körpers heisst das, dass wir den Körper so belasten müssen, dass es zu einer Anpassungsreaktion kommt. Einer Anpassungsreaktion bei der das Gehirn eine Botschaft wie «Achtung, heute wurde der Körper über das gewohnte Mass hinaus belastet – liebe Muskeln werdet stärker, damit ihr künftig solchen Belastungen gewachsen seid». In der Fachsprache nennt man das einen «Superkompensationseffekt» auslösen – eben den Körper stärker machen.
Mit anderen Worten heisst das, dass wir nur dann kräftiger, besser, stärker werden, wenn wir unseren Körper über das gewohnte Mass hinaus belasten. Der Spruch «no Pain – no Gain» [kein Schmerz – keine Verbesserung], der in den 80er und 90er Jahren das T-Shirt so manches Bodybuilders zierte, drückt das kurz und bündig aus: Fortschritt findet ausserhalb der Komfortzone statt!
Qualität statt Quantität
Oft werden wir im Krafttraining von Kunden gefragt, wie viele Wiederholungen sie denn machen sollen oder wie viele Sätze sie trainieren sollen. Die Antwort darauf ist einfach: Im Krafttraining geht es um Intensität, nicht um Dauer. Ich muss meinem Körper eine Anpassungsreaktion abverlangen und das ist anstrengend, ja manchmal gar schmerzhaft. Körperliche Gesundheit und korrekte Übungsausführung vorausgesetzt, mache ich so viele Wiederholungen, wie es nur geht – man trainiert bis zum Muskelversagen. Das Gewicht wird dann so gewählt, dass dieses Muskelversagen, nach ca. 10 bis maximal 15 Wiederholungen auftritt. «Aber das tut weh» hört man dann oft «das brennt im Muskel». «Hoffentlich» pflege ich dann jeweils zu sagen, «deswegen sind Sie ja hier».
Manchmal haben wir auch Kunden, die (ohne medizinische Indikation) drei Sätze absolvieren und in jedem Satz 12 Wiederholungen machen. Sie «sparen» dann im ersten und zweiten Satz Ihre Kräfte, damit es im Dritten auch noch reicht… . Nicht nur verschwendete Zeit, sondern auch der falsche Ansatz: Eigentlich braucht es nur einen einzigen Satz, um den Muskel zu einer Anpassungsreaktion zu zwingen; den aber dafür wirklich bis zum Muskelversagen. Unsere Empfehlung lautet daher: Machen Sie einen, allenfalls zwei Sätze, diese aber (ohne Kompromisse bei der Übungsausführung) bis zum kompletten Muskelversagen! Ihr Training wird dadurch kürzer und gleichzeitig besser. Die so gewonnene Zeit investieren Sie dann gewinnbringend ins Ausdauer- oder Koordinationstraining.
Zusammenfassung:
- Unser Körper ist nur so stark wie er sein muss, um die an ihn gestellten Anforderungen zu erfüllen.
- Um kräftiger/stärker zu werden, müssen wir unseren Körper über das gewohnte Mass hinaus belasten, um ihn zu einer Anpassungsreaktion zu zwingen.
- (Kraft-)Training ist weniger eine Frage der Quantität als der Qualität (Intensität).
- Ein gutes, cleveres Krafttraining heisst: Korrekte Technik und so viele Wiederholungen bis zum Muskelversagen.
- Training ist kein Ponyhof – Fortschritt findet ausserhalb der Komfortzone statt.